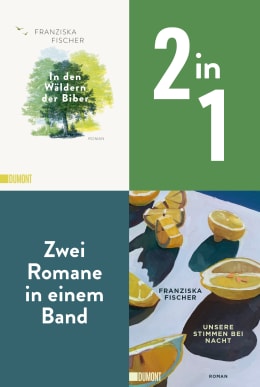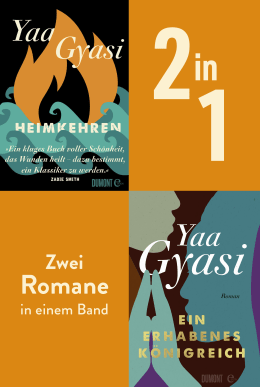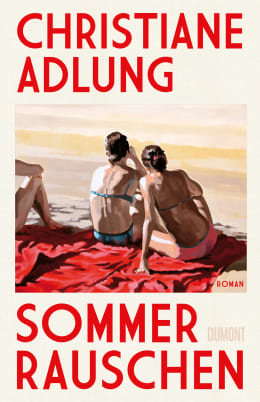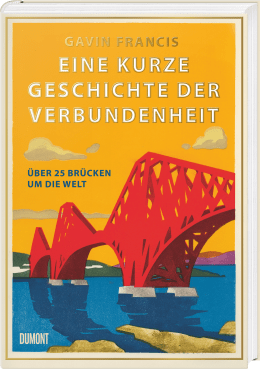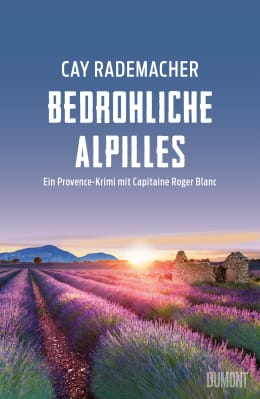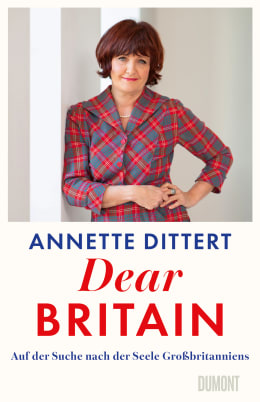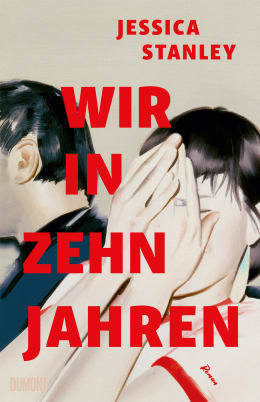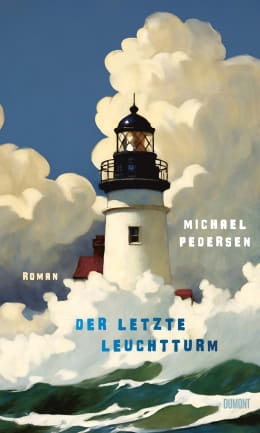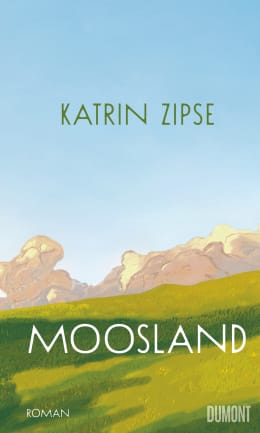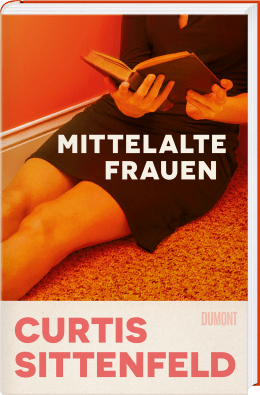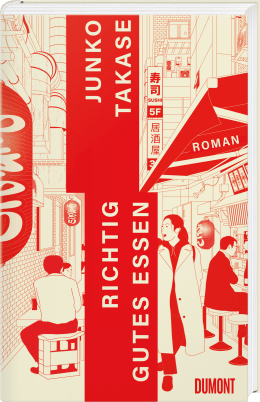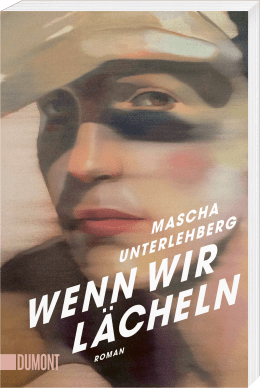Die Rheinreise
Roman | »Erschütternd schön und schön gegenwärtig« DIE WELT
240 Seiten
(2)
Dieser Titel ist in Ihrer lokalen Buchhandlung oder hier erhältlich:
Sofort lieferbar
»Einfühlsam und klar – ein kleines historisches Juwel« The Guardian
1851: Nur drei Jahre, nachdem Arbeiterrevolten Europa im Kern erschüttert haben, kehren die ersten englischen Touristen auf den Kontinent zurück. Sie legen in Baden-Baden ab und fahren mit dem Schaufelraddampfer das für seine romantischen Landschaften berühmte Rheintal hinunter. Neben Franzosen und deutschen Familien befinden sich auch Reverend Charles Morrison mit Frau und Tochter sowie seine unverheiratete Schwester an Bord: Charlotte, eine scheinbar sanftmütige Frau mittleren Alters, hat ihr Leben damit verbracht, sich um die Bedürfnisse anderer zu kümmern. Doch wie der Fluss, auf dem die Gesellschaft reist, birgt auch Charlottes Seele verborgene Abgründe. Als sie in Koblenz einem fremden und doch eigentümlich vertrauten Mitreisenden begegnet, wird sie in einen Strudel aus verdrängten Erinnerungen und unterdrücktem Verlangen gestoßen.
Ein so zarter wie eindringlicher Roman über Reue und unerfüllte Träume, aber auch über die Hoffnung, entgegen gesellschaftlichen Widerständen selbstbestimmt zu leben.
Ein so zarter wie eindringlicher Roman über Reue und unerfüllte Träume, aber auch über die Hoffnung, entgegen gesellschaftlichen Widerständen selbstbestimmt zu leben.
Bibliografie
Seiten:
240
Erscheinungstag:
2025-08-12T00:00:00Z
ISBN:
978-3-7558-1127-5
Ausstattung:
EPUB
Produktsicherheit:
Mehr anzeigen
DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
herstellung@dumont.de
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
herstellung@dumont.de
Sicherheitshinweis entsprechend Art. 9 Abs. 7 S. 2 der GPSR entbehrlich.
Ann Schlee
ANN SCHLEE wurde 1934 in Connecticut geboren und verbrachte Teile ihrer Kindheit in Ägypten, Eritrea und im Sudan. Sie schrieb Kinderbücher, ehe 1980...
ANN SCHLEE wurde 1934 in Connecticut geboren und verbrachte Teile ihrer Kindheit in Ägypten, Eritrea und im Sudan. Sie schrieb Kinderbücher, ehe 1980 mit ›Die Rheinreise‹ ihr erster Roman für Erwachsene erschien. Der Roman stand im Jahr darauf auf der Shortlist des Booker Prize. 2023 verstarb Schlee im Alter von 89 Jahren.
Werner Löcher-Lawrence
WERNER LÖCHER-LAWRENCE, geboren 1956, ist als literarischer Agent und Übersetzer tätig. Er übertrug u. a. Meg Wolitzer, Benjamin Myers, Nathan Hill,...
WERNER LÖCHER-LAWRENCE, geboren 1956, ist als literarischer Agent und Übersetzer tätig. Er übertrug u. a. Meg Wolitzer, Benjamin Myers, Nathan Hill, Benjamin Wood und Hilary Mantel ins Deutsche.
PRESSESTIMMEN
mehr Pressestimmen anzeigen
»[Ein] vergessenes Meisterwerk«
Oliver Pfohlmann, SWR LESENSWERT
»Ann Schlee ist der Geheimtipp der Saison: ›Die Rheinreise‹ ist traumhaft schön.«
Elmar Krekeler, DIE WELT
»[E]in Lesevergnügen!«
Anja Weigmann, NÜRNBERGER NACHRICHTEN
»[E]rschütternd schön und schön gegenwärtig«
Elmar Krekeler, DIE WELT
»eine […] fesselnde […] Studie viktorianischer Seelennöte«
Oliver Pfohlmann, DER STANDARD
»[Ein] vergessenes Meisterwerk«
Oliver Pfohlmann, SWR LESENSWERT
»Ann Schlee ist der Geheimtipp der Saison: ›Die Rheinreise‹ ist traumhaft schön.«
Elmar Krekeler, DIE WELT
»[E]in Lesevergnügen!«
Anja Weigmann, NÜRNBERGER NACHRICHTEN
»[E]rschütternd schön und schön gegenwärtig«
Elmar Krekeler, DIE WELT
»eine […] fesselnde […] Studie viktorianischer Seelennöte«
Oliver Pfohlmann, DER STANDARD
»[Ein] vergessenes Meisterwerk«
Oliver Pfohlmann, SWR LESENSWERT
LESER*INNENSTIMMEN
Weitere Leser*innenstimmen anzeigen
B. B.
Der britische Reverend Charles Morrison ist 1851 mit Frau Marion, der 17-jährigen Tochter Ellie und seiner Schwester Charlotte unterwegs auf einer Reise per Schaufelraddampfer auf dem Rhein. Die „leidende“ Marion soll zu dieser Gelegenheit zu einem Kuraufenthalt abgeliefert werden. Die Beziehungen innerhalb des Grüppchens wirken gespannt, weil einerseits die heiratsfähige Ellie unbedingt vom unziemlichen Kontakt zu jungen Männern ferngehalten werden soll und noch ungeklärt ist, ob die circa 40-jährige Charlotte ihr restliches Leben als alte Jungfer/unverheiratete Tante im Haushalt ihres Bruders verbringen wird. Außerdem tritt Charles als unerträglich pharisäerhafter Typ auf, der jede Kultur und jede Religion außer seiner eigenen zu finsterem Aberglauben erklärt. Den Kölner Dom wird er jedenfalls nicht besuchen. Als Charlotte meint, zwischen Kutschfahrten, Eselsritten und Flusspassagen jenen Desmond Fermer zu erblicken, dessen Heiratsantrag sie vor 20 Jahren unter Charles Zwang ablehnen musste, brechen alte Konflikte zwischen den drei Erwachsenen wieder auf. Dass der mittelalte Herr Newman nicht der inzwischen 60-jährige Fermer sein kann, ist Charlotte jedoch völlig klar. Als Leser zweifelt man zugleich an der Lebenstüchtigkeit von Bruder und Schwester, die damals offenbar verdrängten, dass ein Mühlenbesitzer von einer Ehefrau Mitgift und Mitarbeit erwarten wird, die einer noch jungen Pfarrhaushälterin (bei einem älteren Kollegen von Charles) eher nicht zuzutrauen waren. Charlotte wird heute noch wie ein Dienstmädchen behandelt und auch der Ton der Eltern gegenüber Ellie wirkt alles andere als christlich.
Fazit
Vor der Kulisse eines paranoiden Preußen kurz nach den Ereignissen von 1848, so Lauren Groff in ihrem informativen Nachwort, entwickelt Ann Schlee ein scharfsinniges, präzise beobachtetes Sittengemälde einer Zeit, in der unverheiratete Frauen praktisch zu Leibeigenen eines männlichen Verwandten erklärt wurden. Kein Wunder, dass unter diesen Umständen Marion wie Charlotte so verwirrt wie manipulativ wirken, so dass man stets damit rechnen muss, in ihre Alpträume entführt zu werden. Die Folgen einer Begegnung mit einer Deutschland-erfahrenen britischen Familie mit halbwüchsigen Söhnen blättert schließlich eine Überraschung auf, die die Ereignisse in völlig anderem Licht erscheinen lässt.
Auf nur 240 Seiten entfaltet Ann Schlee ein bemerkenswertes Psychogramm der Familie Morrison, das mir durch die Kürze des Textes, den historischen Hintergrund und die Charakterisierung der exzentrischen Figuren als Lektüre in einem Lesekreis Vergnügen bereiten würde.